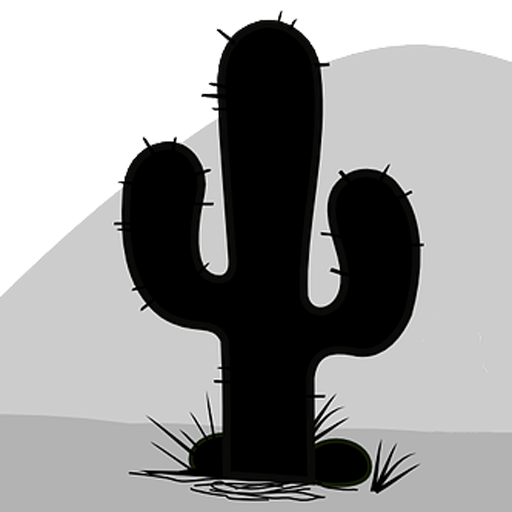Satiren
Das Stück
Mit Theaterstücken verhält es sich wie mit Liebhaberinnen. Manche sind auf den ersten Blick elektrisierend, kokettieren mit ihren Reizen und versprechen ungeahnte Möglichkeiten. Solche Lieben auf den ersten Blick können aber auch oft tückisch werden. Am Ende stehst Du dann enttäuscht vor einem faden Einheitsbrei und weiß nicht so recht, wo und wann Du da zum Höhepunkt kommen sollst. Da strampelst Du Dich dann ab mit abstrakten Räumen, Lichtvorhöfen und chorischem Stöhnen. Versuchst es noch mit ein paar Verfremdungen, einem kleinen dramaturgischen Kniff, ja am Ende sogar mit choreografischen Einlagen.
Aber alle Versuche sind vergeblich. Dem Stück ist kein Drama abzugewinnen. Und nicht nur das. Mittlerweile fragt sich sogar der letzte Depp der Laienspielschar, was der ganze Scheiß eigentlich soll. „Das ist Kunst“ hilft da auch nicht mehr weiter. Die Lebedame verreckt bereits im ersten Akt, das Ensemble stolpert sich durch die Kulisse und die Inszenierung wird zur Folterkammer des Grauens. Von wegen prickelnd, zündend und gehaltvoll. Da kann auch der letzte Griff in die Regie-Trickkiste nichts mehr bewirken. Aber so ist das mit der rosaroten Brille der Verliebten. Du siehst mehr Schein als Sein. Fällst auf die Verpackung rein und beklagst Dich über mangelnde innere Werte. Und du fragst dich leider zu spät, was der Autor mit dem Text eigentlich sagen wollte. Oder die Autorin. Auch egal. Die Eintrittskarten sind gedruckt, die Plakate auch und die Kritik freut bereits sich auf ein Schlachtfeld. Da hilft nur noch die Presseeinladung mit dem dicken fetten Vermerk. „ACHTUNG; ACHTUNG! Das ist ein T H E A T E R P Ä D A D O G I S C H E S Projekt!“ Das hilft nicht immer, aber manchmal. Jedenfalls beim ersten Mal. Danach musst du die Stadt wechseln. Oder doch das Stück. Oder besser die Dramaturgin, die dieses Stück ausgewählt hat. Falls Du das selbst warst:
Dumm gelaufen!
Andere wiederum kommen fade daher und Du gibst ihnen nur eine Chance, weil mal gerade nichts Besseres zur Hand war, oder die Besetzungscouch nur diese Damen zuließ. Oder weil die Deko vom letzten Mal noch passt, die Zuschüsse nicht bewilligt wurden und der Verlag die andere nicht freigab. Eines von dem trifft immer zu, manchmal vieles, meistens jedoch alles.
Im schlimmsten Fall allerdings war die Wahl keine Wahl, und erst recht nicht deine eigene und von Freiwilligkeit mal ganz zu schweigen. Nein, im allerschlimmsten aller Fälle war das Stück ein „Herzenswunsch“ von oben. Von ganz oben. Von der Intendanz. Oder von der Kulturdezernentin. Oder vom Gatten der Kulturdezernentin. Diesem Herrn Karl-Heinz von und zu. Der sitzt im Sparkassenvorstand, ist Schützenkönig bei Blauweissdeppendorf und kennt einen, der einen kennt, dessen Frau dem Kassenwart vom Rotarier Club einmal im Monat die Füße pflegt. Gaaaaaanz wichtiger Mann. Hat Kontakte. Zum Geld. Muss man sich warm halten. Kommt zu jeder Premiere. Immer. Und immer erste Reihe. Und immer in der ersten Reihe mittendrin. Klatscht laut, lacht laut und stinkt. Riechste bis auf die Rampe. Obwohl, Geld soll ja eigentlich nicht stinken. Auch egal. Ist ja auch unser Publikum. Für die machen wir es doch. Oder? Eben. Und ist ja mal was anderes. Hat ja auch seinen Reiz. So ein kleiner Schwank. Mal was für den Boulevard. Die Leute dürfen sich doch auch amüsieren dürfen bei uns. Oder? Ist doch auch Kunst, die Leute zum Lachen zu bringen. Also mach was Schönes draus. Ich verlass mich auf Dich. Bist ein Schatz. Küsschen.
Tja, was soll ich sagen? Shit happens. Aber du machst das Beste draus. Nimmst die Herausforderung an. Setzt alles auf eine Karte. Dein Hirn zündet und spuckt ein Feuerwerk an Einfällen aus. Das Ensemble lässt sich mitreißen. Plötzlich ist alles da. Wie aus einem Guss. Wenn Schwank, dann schwankend. Wie ein angeschlagener Kahn. Ein Schwank auf schwankendem Schiff, eine Schiffsladung voll Heiterkeit, führerlos auf offener See. Oben Sonne, Strand und Aida und unten die prekäre Malocherschicht. Moderne Lohnsklaven knapp über der Armutsgrenze servieren dem Vorstandsortverein Börsenkurse und Provisionen. Gewerkschaftsführer nutteln über die Bühne und lassen sich von Karl-Heinz den Marsch blasen. Tralla und hoppsa. „Eins vor und zwei zurück. Ihr seid arm und ich hab Glück.“ „Und jetzt alle: Vorwärts und nicht vergessen worin unsre Stärke besteht, beim Feiern und beim Fressen, vorwärts und nicht vergessen, das Ak-ti-e-n-pa-ket!“. Die Kolleginnen sind begeistert, das Publikum steht Kopf und die Presse rastet förmlich aus. Seite 1 der Aufmacher „Skandal! Karl-Heinz droht mit Theaterschließung. „ Seite 2 Bericht und Hintergrund: „Unglaublich! Kulturdezernentin lässt sich scheiden.“ Seite 3: Der Kommentar „Unerhört! Fußpflegerin in den Dreck gezogen!“ Seite 4: Feuilleton „Es lebe die Kunst! Aber wer war das Schiff?“ Seite 12: Stellenmarkt: „Theaterpädagogin sucht neuen Wirkungskreis.“
Aus der Diplomarbeit Theaterpädagogik “Über die Kunst des Scheiterns”
Dinslaken, Januar 2011
Zurück
Von der Berufung zum Beruf
Die Frage nach dem Sinn des Lebens erübrigt sich, wenn man sich berufen fühlt. Meine Berufung erfolgte im Alter von 8 Jahren. Was meine Therapeutin viele Jahre später als Schlüsselerlebnis bezeichnen würde, war für mich damals Schlichterdings eine kleine Notlüge, wenngleich auch in besonderer Form.
Es war der 12. Oktober 1964. Es war ein Samstag. Und ich saß im Beichtstuhl. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite : Kaplan Siegfried. Kaplan Siegfried, den wir Kommunionkinder liebevoll Kasi nannten war meine künstlerische Muse. Kapsi lauschte meiner Beichte mit der Ehrfurcht eines staunenden Publikums. Und er war ein begnadeter Zuhörer. Und zwischendurch ermunterte mich immer mit einem „Mhm“, „So, so“ oder auch einem „Ach ja?“. So kam ich Schritt für Schritt zu ausgedehnten Erzählungen. Zugegebenermaßen waren die Geschichten meiner ersten Beichtjahre noch sehr holperig. Es fehlten der rote Faden, der klare Aufbau und vor allem die Wendepunkte. Intuitiv ahnte ich, dass ich da noch besser werden musste. Und so begann ich schon zu Hause an meiner Beichte zu feilen. Ich entschied mich für Form, Zeit und Sprache. Führte in das Thema ein, etablierte die Figuren und setzte die Kipppunkte wie Paukenschläge in einer Partitur. Dann trieb ich die Geschichte zum dramaturgischen Höhepunkt, baute hier und da eine kleine Redundanz ein, lies mich selbst die größten Heldenreisen durchleben und bettete die Katharsis ein in ein fulminantes Finale.
Meine Beichtjahre waren meine Lehrjahre. Kaplan Siegfried mein Meister und die auferlegte Buße mein Applaus. Ich brachte es immer mindestens auf vier `Gegrüßtes seist du Maria´ und zwei `Vater unser´. Darauf war ich stolz! Aber die junge Künstlerin in mir wollte mehr. Da war dieser Hunger nach Anerkennung, nach Beifallsstürmen und „Bravo“ Rufen. Und wenn ich schon keine Standing Ovations erwarten konnte, so wollte ich doch zumindest noch „ einen Rosenkranz beten“ dazu haben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Am 10. Mai 1964 um 10:25 war es soweit: Meine Beicht-Performance hatte ich nach 20 Minuten beendet. Ich hatte alle Register gezogen: von „Lügen“ bis „Stehlen“, von „Eltern nicht ehren“ über „Sonntags arbeiten“ bis hin zu „andere Götter haben“ hatte ich so ziemlich alles eingebaut. Und so saß ich nun da im Beichtstuhl in der Kirche zu unserer Lieben Frau und wartete auf den üblichen Freispruch und der dazugehörigen Buße. Stattdessen aber hörte ich Kasis sonore Stimme murmeln: „War das alles?“ Ich war irritiert. Wie jetzt? Noch mehr? Was denn? Kasi ließ nicht locker. „Hast Du nicht noch mehr auf dem Kerbholz?“ Plötzlich dämmerte es in mir und die Erkenntnis traf mich wie ein Blitzschlag. Mein Kasi wollte eine Zugabe. Das war der Hammer. Eine Zugabe! Mein Kasi! Von mir! Seinem Beichtkind! Mir schossen die Tränen vor Glück in die Augen. Das war er, der Moment des Ritterschlags. Der Ruf nach der Zugabe und zugleich der Ruf der Berufung. Wieder hörte ich Kasis Stimme und diesmal klang es schon fast wie ein Betteln: „Bist du sicher, dass das alles war?“ – „Überleg noch mal.“ – „Da war doch bestimmt noch was!“ Fieberhaft überlegte ich, was ich noch bringen konnte. Kasi wollte mehr. Nein, er brauchte mehr. Ohne eine Zugabe würde ich nicht aus diesem Beichtstuhl kommen. Und ich wollte ihn nicht enttäuschen. Aber was sollte ich noch beichten? Was konnte ich bringen? Womit konnte ich mich toppen? „Falsches Zeugnis abgelegt“? Zu langweilig, das kriegt jede Grundschülerin hin. Die „Totschlag-Nummer“? Zu unglaubwürdig, dafür war ich zu jung. Aber dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Natürlich, das war es. Genau das, und nichts anderes. Das würde Kapsi aus dem Beichtstuhl hauen! Und zwar komplett! Und zwar kolossal und zwar für immer!
Aber ich wusste: diese Nummer würde mich ganz fordern. Und ich wusste auch: diese Nummer würde mein Leben verändern. Diese Nummer würde der Schlüssel zu meiner Biografie oder zumindest ein Absatz in meiner Diplomarbeit. Aber gut. Das wäre später und jetzt ist jetzt. Hier in diesem Augenblick, in diesem Beichtstuhl forderte mein Kapsi eine Zugabe. Und zwar nicht irgendeine, sondern meine! Meine erste Zugabe. Da war er, der Ruf und ich folgte ihm.
Also brachte ich meine Nummer. Sie fing an mit dem schlichten Satz „Ich habe begehrt meines Nachbarn Tochter und die heißt Siegrid.“ Was folgte war eine unzensierte Version meiner geheimen Phantasien in Bezug auf meine Sportlehrerin, garniert mit ein paar Anleihen aus dem Film „Mädchen in Uniformen“. Nach meinem letzten Satz „Wenn ich groß bin, werde ich Sportlehrerin“ folgte Stille. Eine lange, stille Stille. Eine „Stecknadel-fällen-hören-können-Stille.“
Und dann kam, was ich nie vergessen werde. Kasi stand auf, kam aus dem Beichtstuhl heraus auf meine Seite, stellte sich neben mich und sagte. „Vier Gegrüßest seist du Maria, zwei Vater unser und einen Rosenkranz. Oder was meinst du?“ Dann legte er eine Hand auf meine Schulter und schob mich in die nächste Bank. Ich war glücklich. Da war er: mein erster Rosenkranz! Ich hatte es geschafft.
Als Kasi an mir vorbei zum Altar ging, sah ich ein Lächeln auf seinen Lippen und so etwas wie Stolz in seinen Augen. Ich war mir sicher, das war sein stiller Applaus für mich. Ein kleines geheimes Zeichen, dass er mir gab. Das er mir schenken wollte, als Proviant für meinen weiteren Weg.
Da wusste ich, ich würde nicht Sportlehrerin werden. Ich würde Geschichten erzählen. Geschichten von mir. Geschichten von mir und den Menschen in meiner kleinen Welt. Laute und leise. Lange und kurze. Vor großem und kleinem Publikum. Und ich würde die Menschen berühren und anstiften. Anstiften zum Lachen, Weinen, Träumen und Kämpfen.
Warum? Einfach so. Weil es Spaß macht. Und weil es gut tut. Weil es lebt.
Zurück
Die Kunst und Ich
Theaterspielen ist für mich Leidenschaft, Berufung und Profession. Wenn ich heute so darüber nachdenke, dann zeigte sich meine Leidenschaft für die Bühne bereits im zarten Alter von 3 Monaten. Damals hatte ich meinen ersten Auftritt vor Publikum, wenn auch nur im familiären Kreis. Leider war es auch keine Sprechrolle, aber für den Anfang will man ja nicht meckern und bescheiden sein. Aber immerhin: es war eine Uraufführung und abgesehen davon eine einmalige Angelegenheit. Zum besseren Verständnis hier die Details: Der Ort: Oberhausen, die Bühne: der Altar der Klosterkirche zur unseren lieben Frau. Bühnenbild: ein Taufbecken. Rollenbesetzung: Mia Völker als Mutter, Paul Völker als Vater, Leo Schmitz und Brunhilde Oehmen als Taufpaten. Regie: Pater Leppich. Mir war in dieser Inszenierung die Rolle des Taufkindes zugedacht. In dieser zentralen Position hatte ich nichts weiter zu tun, als dem Geschehen entspannt zuzusehen und im richtigen Moment zu schreien. Jede Fachfrau weiß, dies ist die schwerste Kunst überhaupt: aus der Passivität heraus im entscheidenden Moment zu agieren. Und dies authentisch, überzeugend und raumfüllend. Da ich noch kein Drehbuch lesen konnte, wusste ich natürlich nicht, an welcher Stelle mein Schreien vorgesehen war. Mir blieb also nur eines, nämlich mich voll und ganz auf meine Intuition zu verlassen, alle Sinneskanäle zu schärfen, hellwach zu sein im Augenblick und dem ersten Impuls zu vertrauen, der mir sagen wird: JETZT.
Untalentierte Babys machen den Fehler und schreien viel zu früh und dummerweise dann auch noch genau in den Text des Priesters herein. Grober Fehler! Wenn er sagt „Ich taufe dich“, dann ist das noch kein Grund zu schreien, es sei denn, man hat die Rolle so angelegt, dass man überzeugte Atheistin ist oder Widerstandskämpferin. In diesem Fall hat man aber nicht zu früh geschrieen, sondern zu spät. Als Atheistin und Widerstandskämpferin schreit man bereits schon auf dem Weg zur Kirche und kackt in die Windeln, um das Schlimmste zu verhindern. Da ich jedoch weder das eine noch das andere war, waren meine Windeln blütenrein und meine Stimmbänder noch nicht ruiniert.
Also lag ich ganz entspannt in den Armen meiner Mutter und machte zur Eingangsliturgie ein bisschen Zappeln als Warming Up. Gähnen, Räkeln, Strecken, halt das kleine Nachtischlämpchen-Aufwärm-Programm. Mit den Fürbitten fand ich, dass es Zeit war für die Stehlampe mit Muttern. Ich wählte als Übung das Mimikry-Spiegeln. Bis auf den Wechsel klappte es ganz gut, aber ich wusste ja bereits, dass Muttern die Führung selbst beim Training nicht aufgibt. Aber das ist ein anderes Thema. Mit dem ersten Lied ging dann die Deckenleuchte an und das ganze Ensemble startete mit Stimm- und Gesangsübungen. Die Improvisation dauerte 4 Strophen, dann ging es auf die Bühne. Um meine Konzentration zu schärfen und mich in die Rolle einzufinden, hatte ich mir einen genialen inneren Dialog ausgedacht: „Ich habe es nicht verdient, mit Wasser überschüttet zu werden. Erst recht nicht mit kaltem. Und ich bin unschuldig. Jawoll. Unschuldig. Aber so was von unschuldig. Und außerdem ruiniert ihr mir die Frisur. Das ist gemein. Das werde ich mir nicht gefallen lassen. Nicht nochmal. Und nicht hier. Und nicht vor allen Leuten. Wagt es ja nicht! Ich sagte, wagt es….. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!“
Zurück